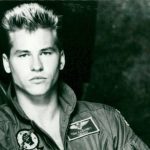„Ghiblify me“: Warum der Social-Hype dem Ghibli-Erfinder gar nicht gefällt

Überall tauchen auf einmal Anime-Versionen von Profilbildern auf. Dahinter steckt eine neue Funktion von ChatGPT. Der Erfinder des Originals hat indes eine klare Haltung dazu.
Sie sind plötzlich überall: Anime-Figuren, die wie unsere Freunde aussehen. Der Kollege als Muppet. Und die Nachbarin wie eine Figur direkt aus den Simpsons. Eine neue Bilderfunktion von ChatGPT sorgt in den sozialen Netzwerken derzeit für einen riesigen Hype. Dabei hat der klare Schattenseiten. Und ausgerechnet dem Mann hinter der beliebtesten Vorlage geht das gehörig gegen den Strich.
Der Trend begann vergangene Woche mit einer Neuerung bei ChatGPT 4o: Das erlaubt nun erstmals Nutzern, direkt mit dem Chatbot Bilder zu erstellen – auch innerhalb des kostenlosen Angebots. Die Folge war eine regelrechte Flut an KI-Bildern. Ob Promis, Politiker, historische Momente oder einfach sich selbst und die eigenen Freunde: Unzählige Social-Media-Nutzer posteten ein KI-Bild nach dem nächsten.
Studio Ghibli geht viral
Zwar gibt es unterschiedliche Stile, die genutzt werden können – etwa den der Zeichentrickserien „Rick und Morty“, „Family Guy“, der „Simpsons“ oder auch die Puppen aus der Sesamstraße. Der Hype beschränkt sich aber weitgehend auf den markanten Zeichenstil der berühmten Anime-Schmiede Studio Ghibli. „Ghiblify“, also etwa „ghiblisieren“, nennt sich der Trend entsprechend. Sogar OpenAI-Chef Sam Altman nutzt mittlerweile eine Ghibli-Version seiner selbst als Profilbild.
Dass ausgerechnet Studio Ghibli zum KI-Trend wird, dürfte Hayao Miyazaki allerdings sauer aufstoßen. Der Chefzeichner und Studio-Gründer hat sich zum aktuellen Hype zwar bislang nicht geäußert, in einer Dokumentation aus dem Jahr 2016 positionierte er sich aber klar zu den damals aufkommenden technologischen Unterstützungen beim Zeichnen: „Es ist eine Beleidigung für das Leben selbst“, erklärte er damals über die sich in den Kinderschuhen befindliche KI-Hilfe für Zeichner. Die moderne Kultur empfinde er als „dünn, flach und aufgesetzt“, berichtet die Journalistin Margaret Talbot.
Die Sorge um die Natur und die Gefahren der Technologie sind zentrale Elemente im Werk seines Zeichentrick-Studios. Obwohl Miyazaki mit harmlosen Serien wie „Heidi“ bekannt wurde, sind die meisten Filme des Studios alles andere als Kinderfilme. Zwar sind Geschichten wie „Prinzessin Mononoke“ oder „Chihiros Reise ins Zauberland“ oft märchenhaft inszeniert, die darunterliegenden Themen wie Trauma oder der Kampf um die Umwelt sind – ebenso wie der oft hohe Gewaltgrad – klar an Erwachsene gerichtet. Entsprechend konnte das Studio bereits zweimal den Oscar für den besten Animationsfilm mit nach Hause nehmen.
Kritik am ChatGPT-Trend
Auch von anderer Seite wächst die Kritik an dem Viraltrend. Der Einsatz von KI für Zeichnungen entwerte das Handwerk und die Kunst, argumentieren zahlreiche Künstler. Andere sehen es als weitere Eskalation im Streit zwischen Kreativen und den KI-Firmen, die deren Werke zum Trainieren ihrer Modelle nutzen. Auch OpenAI war in die Kritik geraten, weil die Firma Werke für das Training genutzt hatte, ohne diese zu lizenzieren. Altman hatte zuletzt auch argumentiert, dass KI-Firmen nicht profitabel arbeiten könnten – wenn sie die Werke nicht kostenfrei nutzen dürften.
Von dem Viraltrend könnte OpenAI deshalb auf eine völlig überraschende Weise profitieren, argumentiert die Privacy-Expertin Luiza Jarovsky. „Um Ghibli-Bilder zu erstellen, laden Tausende von Menschen ihre Gesichter und privaten Fotos hoch“; erklärte sie bei „X“. „Als Ergebnis hat OpenAI nun kostenlos und unkompliziert Tausende neue Gesichter bekommen, um seine KI-Modelle zu trainieren.“