Forscherin: Wie Bürokratie unsere Psyche belastet
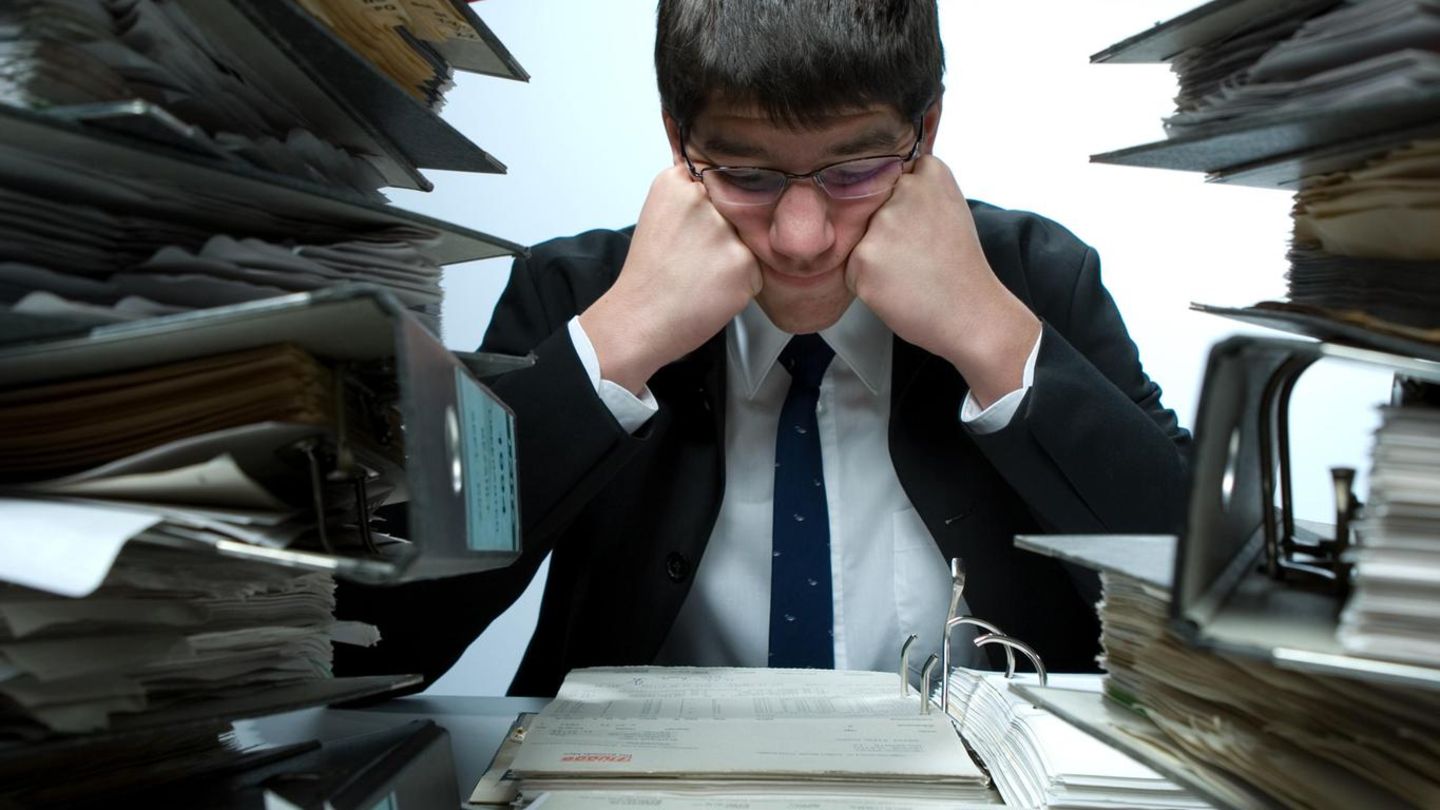
Die Volkswirtin Annette Icks hat die psychologischen Kosten der Bürokratiebelastung erforscht. Sie sagt: Einige Menschen finden kreative Wege, um mit der Regelwut klarzukommen.
Frau Icks, wir alle kennen diese kafkaesken Momente, in denen wir an der Bürokratie verzweifeln. Sie haben als Volkswirtin die psychologische Komponente untersucht. Wie kam es dazu?
Wir arbeiten in unserer Forschung schon seit langem mit Unternehmen und führen qualitative und quantitative Befragungen durch. Wenn es in den Gesprächen um das Thema Bürokratie geht, brechen in den Gesprächen immer sehr viele negative Emotionen hervor. Dabei geht es nicht um den zeitlichen Faktor, auch nicht um die finanziellen Kosten von Bürokratie, sondern wirklich um die damit verbundenen Gefühle. Das haben wir die psychologischen Kosten genannt. Sie werden – und das hat mich wirklich überrascht – bei Dreiviertel der befragten Unternehmen als mindestens so hoch, wenn nicht noch höher wahrgenommen als der zeitliche und finanzielle Aufwand.
Um welche Gefühle geht es dabei?
Wut, Aggression, Stress, bis hin zu Ohnmachtsgefühlen und Fluchtinstinkten. Knapp die Hälfte der Befragten meinte: Ich bin total verunsichert, möchte mich regelkonform verhalten, aber weiß bei dem Dickicht an Vorgaben gar nicht wie.
Was konkret haben Ihnen die Leute Ihnen erzählt?
Da war zum Beispiel ein Maschinenbauer, der von der Arbeitsschutzverordnung erzählte. Gemäß dieser muss jedes Unternehmen seine Beschäftigten einmal jährlich zu Sicherheit und Gesundheitsschutz unterweisen. Der Unternehmer versteht, dass Arbeitsschutz wichtig ist, und will Sorge dafür tragen, dass seine Beschäftigten nicht in Gefahrensituationen kommen. Aber für ihn war es ein Unding, dass er die Unterweisung auch langjährigen Mitarbeitern immer wieder angedeihen lassen muss. Denken die denn, seine Leute hätten ein Gedächtnis von maximal einem Jahr, klagte er. Dann gab es noch die Sache mit dem Leiterbeauftragten.
Es gibt ernsthaft so etwas wie Leiterbeauftragte?
Natürlich. Das ganze Beauftragtenwesen ist für viele Unternehmen ein großes Ärgernis. Ein Unternehmer beklagte, dass er einen Leiterbeauftragten benennen soll. Dieser ist dafür verantwortlich, dass die Leitern trittsicher sind und ordentlich gewartet werden. Die Vorgaben sind aber häufig so formuliert, dass sie gar nicht verständlich sind. Was ist zum Beispiel damit gemeint, Leitern vor Ort und in angemessenem Umfang sicher zu halten? Werde ich in Haftung genommen, wenn ein Mitarbeiter von der Leiter fällt? Solche Dinge lösen Wut und Unverständnis aus, und die Leute fragen sich: Was denken sich „die da oben“ eigentlich? Das sind Menschen, die in der Regel nie ein Unternehmen geleitet haben, aber sie wollen meinen Betrieb jetzt kontrollieren?
Ist die Belastung durch Bürokratie in den letzten Jahren gewachsen?
Auf jeden Fall, es ist deutlich mehr geworden. Für viele Unternehmerinnen und Unternehmer ist das Maß des Erträglichen überschritten und ein Kipppunkt erreicht. Das haben wir auch in unseren Studien gezeigt und drei Gruppen gebildet: die Unbelasteten, die Pragmatischen und die Verdrossenen. Der Anteil der Verdrossenen ist deutlich gestiegen. Vor einem Jahr wurde von der früheren Bundesregierung das vierte Bürokratieentlastungsgesetz verabschiedet. Aber es ist nicht messbar, dass dadurch etwas besser geworden ist.
Hat es Auswirkungen auf die Geschäfte, dass so viele verdrossen sind?
Leider ja. Die Hälfte der Befragten will ihre Investitionstätigkeit verringern. Projekte werden in die Zukunft verlagert oder ganz abgesagt, weil die Genehmigungsverfahren so lange dauern. Die Unternehmerinnen und Unternehmer haben zum Beispiel Angst, im Bereich des Klimaschutzes rechtliche Probleme zu bekommen, weil die Vorgaben deutlich strenger geworden sind. Was ich besonders gravierend finde: Eigentlich sind das Menschen, die gerne Unternehmer oder Unternehmerin sind, weil sie da was bewegen können. Mittlerweile sagen aber mehr als 80 Prozent von ihnen, dass die Freude am unternehmerischen Tun verloren geht. Das ist nicht nur für den einzelnen Betrieb schlimm, sondern auch ein Problem für die gesamte Volkswirtschaft.
Was ist mit den Pragmatikern? Wie verhalten sie sich?
Aufgrund der Komplexität der bürokratischen Vorgaben gehen sie pragmatisch vor: Etwa ein Viertel von ihnen – also ein wesentlicher Prozentsatz – verzichtet bewusst darauf, einzelne Vorgaben im Unternehmen umzusetzen. Wir haben das den autonomen Bürokratieabbau genannt. Sie verzichten bewusst darauf, alle Regelungen umzusetzen.
Sie lassen also einfach Sachen weg und hoffen, dass es keiner merkt?
Genau.
Gibt es einen Unterschied zwischen kleinen und großen Unternehmen?
In unserer letzten Studie haben wir herausgefunden, dass die kleinen Unternehmen eine höhere finanzielle Belastung haben. Sie liegt bei gut 6 Prozent Bürokratiekostenanteil am Umsatz, bei den Großen sind es etwa 1,5 Prozent. Auch bei den psychologischen Kosten sind die Kleinen deutlich belasteter und reagieren auch erregter. Das liegt daran, dass sie über geringere Ressourcen verfügen als große Unternehmen, aber dennoch ähnlich viele Vorgaben erfüllen müssen.
Lehnen die Unternehmerinnen und Unternehmer die Bürokratie denn grundsätzlich ab?
Nein, sie sehen durchaus, dass manche Vorgaben wichtig sind. Bei der Normung zum Beispiel, die in der Regel mit hohen Kosten verbunden ist, hören wir keine Klagen. Die Unternehmen betrachten die Vorgaben als sinnvoll und lassen ihre Maschinen nicht nur prüfen, weil es vorgeschrieben ist, sondern weil sie mit den DIN-Normen nachweisen können, dass sie gute und geprüfte Maschinen verkaufen.
Was können Lösungen sein?
Eine wesentliche Lösung wäre, Vorgaben praxisnäher, weniger aufwändig und transparenter zu gestalten. Insofern ist es positiv, dass neue Ministerium für Digitalisierung und Staatsmodernisierung nicht nur einzelne Regulierungen vereinfachen, sondern das große Ganze im Blick haben soll. Wir halten es in diesem Zusammenhang für wichtig, dass ein Paradigmenwechsel stattfindet, weg von der kontrollierenden Misstrauenskultur hin zu einer vertrauensbasierten Einstellung. Wir sollten davon ausgehen, dass die Unternehmen von sich aus darauf achten, dass keine Unfälle passieren, dass sie Compliance-Regeln beachten. Schwarze Schafe müssen dann umso härter sanktioniert werden.




